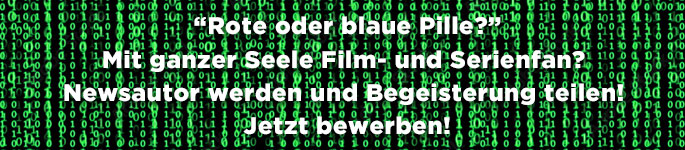Es war ein Film, der Kritiker begeisterte und Scarlett Johansson über Nacht zum Star machte: Lost in Translation von Sofia Coppola. Die damals 18-jährige Schauspielerin überzeugte mit zurückhaltendem Spiel, Sensibilität und einem melancholischen Charme, der sie für viele zum Inbegriff der modernen „femme fatale“ machte. Doch was als großer Durchbruch gefeiert wurde, entpuppte sich als Doppelbödigkeit eines Systems, das Frauen schnell idealisiert und ebenso schnell auf ein Klischee reduziert.
In einem Interview mit Vanity Fair sprach Johansson nun offen über diese Schattenseite ihrer Karriere. „Ich wurde wie ein Objekt behandelt, nicht wie eine Künstlerin“, so ihr nüchternes Fazit. Die Rollen, die man ihr in den Folgejahren anbot, orientierten sich kaum an ihrer Schauspielkraft - sondern eher an der Vorstellung, sie als sinnliche Projektionsfläche zu inszenieren. „Es war, als hätte man mir ein Etikett verpasst, das ich selbst nie gewählt hatte.“
Gerade die Doppelrolle der Branche - Frauen in sexy Posen zu vermarkten, gleichzeitig aber ihre Ernsthaftigkeit infrage zu stellen - stellt Johansson scharf heraus. „Man verlangt von dir, verführerisch zu sein und verurteilt dich dafür, wenn du es bist.“ Diese Ambivalenz zieht sich durch viele weibliche Karrieren in Hollywood, besonders bei jungen Schauspielerinnen, die früh in stereotype Rollen gedrängt werden.
Filme wie Match Point oder Die Insel setzten gezielt auf ihre erotische Ausstrahlung, ohne ihr schauspielerisches Potenzial wirklich auszuschöpfen - und selbst in ambitionierten Werken wie Under the Skin, wo sie schauspielerisch neue Wege beschritt, blieb die Inszenierung oft auf ihre sinnliche Außenwirkung fixiert.
Erst später - durch die vermehrte Auswahl selbstbestimmter Rollen oder etwa mit ihrer Oscar-nominierten Leistung in Marriage Story - konnte Johansson sich nach und nach aus dieser Schublade befreien. Dank steter Beharrlichkeit und dem Willen, mehr zu sein, als nur ein schönes Bild auf der Leinwand.
Ihr heutiger Rückblick ist dabei mehr als nur eine persönliche Abrechnung. Er ist ein Plädoyer gegen die Objektifizierung in der Filmindustrie und für eine Branche, die Frauen nicht in Klischees fesselt, sondern ihnen echte Charaktere zutraut. Denn wahres Talent beginnt dort, wo das Klischee aufhört.