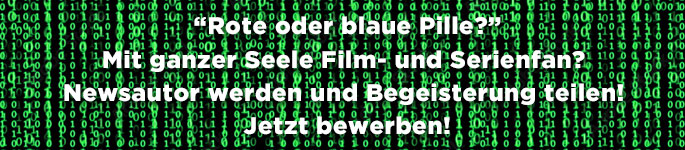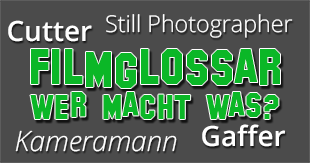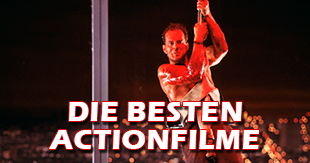Wissenschaftlichkeit: Vom forschenden Geist zum Effektgewitter?
Einer der größten Unterschiede betrifft die wissenschaftliche Neugier, die Star Trek einst definierte.
In Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert war Wissenschaft nicht nur Kulisse. Episoden wie "Besuch von der alten Enterprise" (engl.: "Relics"), "Ursache und Wirkung" (engl.: "Cause and Effect") oder "Der Reisende" (engl.: "Where No One Has Gone Before") bauten ihre Spannung auf physikalischen oder astronomischen Spekulationen auf – nie perfekt realistisch, aber immer plausibel genug, um die Fantasie anzuregen. Man hatte das Gefühl, die Crew wäre tatsächlich unterwegs, um Unbekanntes zu erforschen.
Heute ist der wissenschaftliche Anspruch oft eher atmosphärisch als strukturell. Technobabble (erfundener, technisch klingender Fachjargon in Sci-Fi) existiert weiterhin, dient aber häufig dazu, die Handlung zu beschleunigen oder visuelle Effekte zu legitimieren. Wer moderne Serien schaut, merkt: Die visuelle Inszenierung hat an Gewicht gewonnen – große Explosionen, ungewöhnliche Kamerafahrten, beeindruckende Raumzeitszenarien. All das sieht großartig aus, doch gelegentlich übertönt es die innere Logik.
Dazu kommt ein Phänomen, das vielen modernen Produktionen eigen ist: Plot-Holes werden eher durch Tempo und Effekte kaschiert. Was im klassischen Trek durch technologische Erklärungen oder sorgfältige Konstruktionen ausgeglichen wurde, wird heute manchmal schlicht überschrieben – ein Sternenflottenexperiment geht schief, ein Dimensionsriss öffnet sich, und die Lösung kommt so schnell wie der Zusammenbruch. Das ist nicht als Kritik gemeint, sondern als Beobachtung eines generellen Trends im zeitgenössischen Sci-Fi-Fernsehen.
Serialisierung: Segen, Fluch – oder einfach eine andere Kunstform?
Die moderne Serienwelt liebt fortlaufende Handlungsbögen.
Heute fühlt sich eine Staffel eher wie ein zehnstündiger Film an, der in einzelne Kapitel – also Folgen – unterteilt ist, statt wie eine Sammlung kleiner, aber emotional starker Höhepunkte. Star Trek - Discovery etwa baut fast jede Staffel wie ein Rätsel auf, dessen Lösung erst im Finale präsentiert wird. Das erzeugt Spannung, aber es führt auch dazu, dass weniger Zeit bleibt für ruhige Momente – jene kleinen Atemzüge, in denen klassische Figuren wie Jadzia Dax oder Geordi La Forge früher ihre Menschlichkeit zeigten.
Während ältere Serien durch Ruhe und Wiederkehr Bindung erzeugten, erzeugen moderne Serien durch Tempo und Emotionen Intensität. Beides hat seinen Wert, doch die Wirkung ist unterschiedlich.
Ensemble vs. Protagonist: Wenn das Teamgefühl verblasst
Ein oft übersehener Unterschied betrifft den Fokus.
Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert und Deep Space Nine erzählten konsequent als Ensemblewerke. Selbst Nebenfiguren wie Odo, Nog oder Guinan hatten eigene Mini-Arcs, die sich über Jahre entwickelten. Man spürte: Die Station oder das Schiff war ein lebendiger Ort.
Viele neuere Produktionen konzentrieren sich dagegen stärker auf einzelne Hauptfiguren – Michael Burnham in Star Trek - Discovery, Jean-Luc Picard in Star Trek - Picard. Das entspricht modernen Erzählkonventionen, kann aber die Vielfalt und Wärme eines Ensembles reduzieren. Es entsteht ein anderes, engeres Seriengefühl.
Also: War früher nun alles besser?
Das wäre zu einfach.
Es gibt hervorragende moderne Trek-Momente, die emotionaler, persönlicher und mutiger sind als vieles aus den Neunzigern. Und es gibt klassische Folgen, die schlicht handwerklich durchfielen.
Aber die Unterschiede sind klar:
- Klassisches Star Trek setzte auf Ruhe, Subtilität, Wissenschaft und Teamkultur.
- Modernes Star Trek setzt auf Tempo, Emotion, Serialität und visuelle Wucht.
Ob man das eine oder das andere besser findet, hängt weniger von Treue zur Marke ab als von der Frage, welche Art von Science-Fiction man sehen möchte:
das leise Philosophieren eines Sternenflottenkapitäns – oder den flammenden Sprint eines modernen Streamingdramas.
Am Ende ist es wohl wie mit den Sternen: Manche leuchten ruhiger, manche heller. Ihren Wert verlieren sie deshalb nicht.