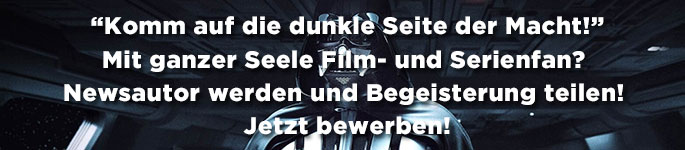Bewertung: 3.5 / 5
Der eher als schlicht bekannte Germain (Gérard Depardieu) kann ihm geschlagenen Alter von ziemlich genau fünfzig Jahren weder lesen noch richtig schreiben. Eines Tages lernt er auf einer Parkbank die gutmütige Dame Marguerette (Gisèle Casadesus) und freundet sich mit ihr an. Als sie ihm aus ihren mitgebrachten Romanen vorliest, entdeck Germain die Faszination an geschrieben Worten für sich.
Mit leisen Tönen und kleinen Worten berichtet Jean Becker in seinem Film über die Bedeutung der Bildung. Fast unscheinbar und vielleicht etwas unpopulär werden hier große Welten aufgemacht. Es ist die Freude an der Literatur, die den Arbeiter Germain in eine Welt führen, die er nie gekannt hat. Er selbst hält sich nicht für sonderlich gebildet und scheint seinen Lebtag mit den immer gleichen Dingen zuzubringen. Das Umsorgen der Mutter, das Führen einer Beziehung zu der hübschen Annette und das Treffen mit Freunden in seiner Stammkneipe. Doch als er eben auf die weise Margueiette trifft, kommt der Analphabet in die Versuchung der Worte. Im Prinzip bietet sich diese Geschichte spielend leicht dazu an, an ihr eine Systemanalyse und Ideologiekritik zu üben. Tatsächlich bringt aber das gesamte Konzept ein großes Problem mit sich, welches sich auch eben in gängigen Stereotypen wiederfindet. Der Film berichtet von einer Mehrklassengesellschaft, nach welcher es mindestens eine Arbeiterklasse und eine intellektuelle Elite gibt. Das ist ein allzu bekanntes Klischee, nach welchem die Arbeiter nur durch Aufklärung von höheren und vielleicht besser betuchten Instanzen eigentlich die Möglichkeit bekommen, sich unabhängig weiterzuentwickeln. Interessant ist ja, dass diese Maxime durchaus noch ihre Berechtigung hat, allerdings sind Arbeiter im klassischen Sinne heute nicht mehr die Arbeiter der Gesellschaft, wodurch das Werk sich so ein wenig altbacken anfühlt.
Doch das brauch es wohl auch, wenn es um ein sehr intellektuelles Thema geht. Im Prinzip kann man diesen Film so ein wenig als My Fair Lady (1964) in etwas abgewandelter Form verstehen. Doch im Gegensatz zu dem Golden Age-Klassiker, vertritt dieser Film dabei durchaus die Ansicht, daß es nicht darum gehen muss, die gesamte wirtschaftliche Existenz und dadurch die Erfüllung eines Rollenbildes an eine Art Legitimierung dessen zu binden. Die Rolle des übergewichtigen, aber liebenswürdigen Blödels ist Gérard Depardieu sicherlich auf den Leib geschrieben. Schließlich bewies er mit Asterix und Obelix gegen Caesar (1999) und einigen zumindest recht interessanten öffentlichen Auftritten, beziehungsweise deren Wertung durch die Medienwelt, daß man ihm das Stigma da nicht mehr absprechen wird. Allerdings ist eben gerade diese Rolle auch so ein wenig klischiert. Gerade wenn es um die Vergangenheit von Germain geht, würde sich Freud wohl freuen. Die persönlichen Schicksalsschläge durch die Vergangenheit werden hier zwar nicht als Grundmotivator für alles Treiben im Film genommen, was man ihm durchaus zugutehalten möchte. Auf der anderen Seite scheint genau diese Episode eben einen Grund dafür bieten zu wollen, warum diese Figur eben relativ wenig Bildung erfahren hat. Fraglich ist allerdings, ob das nötig ist für die Figur, nötig ist für den Film und auch metaphorisch nötig ist, für die Menschheit. Doch das tut dem Film gar keinen Abbruch, weil Depardieu seine Figur mit so viel Charme und Witz spielt. Man sieht da einfach Obelix: Tollpatschig, Sympathisch, lebensfroh und sehr zart. Dieser Kontrast war schon immer sehr interessant, weil sich das eben keineswegs in dem öffentlichen Erscheinen des Schauspielers und damit der Figur widerspiegelt.
Glücklicherweise verzichtet dieser hochinteressante Genremix aus Komödie, Drama und einer sehr andersartigen Liebesgeschichte des Kinos, auf die üblichen Manierismen von solchen Filmen. Man hat da einen Mann, der in einer festen monogamen Beziehung steht, er trifft eine Frau und was daraus folgt, ist ein großes Drama, begründet mit einem Missverständnis. Und der Film setzt dafür durchaus seine Weichen, weil er die Figuren gekonnt in Position bringt, während die Hauptfigur eher unabsichtlich schweigt, die Frau nach spioniert und so weiter und so fort. Doch daraus wird eben kein großes Drama, sondern es ist ein relativ schnell geklärtes Missverständnis zwischen den Figuren, dass darüber hinaus auch nicht zur Katharsis des gesamten Werkes wird. Etwas witziger hingegen ist da die Wahl des Hauptdarstellers in Depardieu auf einer ganz anderen Ebene. Denn nicht gänzlich geklärt wird, wie alt die Figur ist, scheint es so zu wirken, als solle sie ungefähr das gleiche Alter haben, wie seine Freundin. Dennoch liegen zwischen beiden ungefähr dreißig Jahre, die keinerlei Referenzierung im Film erfahren. Das muss ja auch nicht zwangsläufig sein, die Tatsache, dass Depardieu hier aber einen deutlich jüngeren Mann verkörpert, der auch eindeutig nicht mehr so jung wirkt, ist irgendwie belustigend. Ob das einem absurden Casting geschuldet ist, oder tatsächlich von vorneherein so geplant war. Bleibt indes offen.
Zentral für die Geschichte indes die Liebe. Eine Liebe, die sich so ein wenig aus einer sympathischen Idiotie der Hauptfigur in einen kleineren Konflikt mausert. Doch Liebe ist in diesem Werk nicht auf einer sexuell interessierten Ebene zu verstehen, sondern es geht um philosophische, Meta-Physische, nach welcher die Figuren schon ein wenig füreinander empfinden, wie auch der Umstand zeigt, daß Germain eine lange Reise auf sich nimmt, um seine Freundin wiederzusehen. Es ist anders und keineswegs einfach nur ein Abändern der Parameter wie in Werken wie Harold & Maude (1971) oder in gewisser Weise Léon – Der Profi (1994). Auch ist es nicht vergleichbar mit der Beziehung, die Germain zu seiner Mutter pflegt. Es ist eine Beziehung, die zwar durchaus auf Interesse und Sorge um den jeweils anderen beruht, aber das ist ja bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. Gleichsam ist das auch spannend, weil das Alter der beiden ja durchaus im Film weit auseinander gehen soll. Und insofern nimmt der Film sich auch dem ständigen Generationenkonflikt zweier unterschiedlicher Sozialisationen oder Zeiten an. Dabei liegt eine besondere Spannung in dem Austausch der Figuren, dem sich viele Menschen, ob einer ganz eigenen Welt, nur marginal bis gar nicht stellen. Der Film ist dabei eben nicht nur ein Plädoyer für die Sprache, sondern auch für das Anwenden dieser und den Mut dafür aufzubringen dies zu tun. Dabei schafft der Film ganz viele sehr starke Emotionen in seine Dialoge und letztliche Katharsis zu legen, weshalb er sehr anrührend ist.
Manch ein Weg, den Das Labyrinth der Wörter einschlägt, mag etwas verwirrend sein und in eine Sackgasse führen. Doch was daraus zwischenmenschlich entsteht ist nicht nur durch die Hauptfiguren großartig getragen und vorgetragen, sondern auch sehr packend und emotional. Zwischen den Zeilen bietet dieser Film so viele relevante Fragen zum Mensch sein und lässt dabei den Charme und die Unterhaltung nicht außen vor.